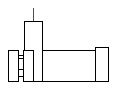Die Burg Königstein im Taunus
Weithin sichtbar thront die Burgruine, das Wahrzeichen Königsteins mit seinem noch immer 34 Meter hohen Turm auf dem rund 450 m hohen Burgberg über der Stadt.
Das 1796 von französischen Revolutionstruppen gesprengte Bauwerk hat seinen Ursprung in einer wesentlich kleineren Gipfelburg aus der Stauferzeit, wohl über Resten einer noch älteren Anlage. Zuverlässig lässt sich die um 1215 erstmalig urkundlich erwähnte Burg durch sogenanntes Fischgrätmauerwerk (opus spicatum) erst auf die Zeit von König Konrad III. datieren.
Eine Sage nennt freilich schon König Chlodwig als Erbauer der Burg, nachdem ihm dort auf einem Jagdausflug eine Jungfrau erschien. Sie prophezeite ihm, im Zeichen des Kreuzes würde er in der nächsten Schlacht siegen. Dass Chlodwig hier tatsächlich den Entschluss fasste, Christ zu werden, darf bezweifelt werden, doch gewann er in diesem neuen Glauben im 4./5. Jahrhundert die wichtige Schlacht gegen die Alamannen bei Zülpich. Fränkische Gräber aus nachfolgender Zeit belegen, dass auch im Taunus Franken die Alamannen als Bevölkerung nördlich des Mains ablösten.
Königstein wurde gegen Ende des 12. Jahrhunderts zur Sicherung der wichtigen Reichs- und Handelsstraße von Frankfurt nach Köln, im Verbund mit den Burgen Falkenstein, Kronberg und Eppstein, errichtet. Spätestens ab 1239 hatten die Ministerialen von Münzenburg (Wetterau) das Reichslehen inne. Schon 1255 folgten ihnen die Falkensteiner, die diesen Namen von ihrer Stammburg am Donnersberg in der Pfalz mitbrachten. Bis zu ihrem Aussterben 1418 bauten sie – nicht ohne Rückschläge durch Kriegsschäden – die Burg zu einem Herrschaftssitz aus und erwirkten 1313 die Stadtrechte für den Flecken Königstein, der sich innerhalb der Vorburg am Fuße des Burgbergs entwickelt hatte.
Von 1418 bis 1535 wurde das Reichslehen vom Geschlecht der Eppsteiner, die in dieser Zeit von Herren zu Grafen erhoben wurden, betreut. Vor allem Graf Eberhard IV. baute das Anwesen zum repräsentativen Residenzschloss um, von dem die bis heute als Fragment erhaltene Schaufassade an der Ostseite der Kernburg stammt. Aber er fing auch an, die Burg in eine Festung umzuwandeln, um den effektiver werdenden Kanonen besser standhalten zu können. Ab 1535 folgt dem kinderlosen Grafen sein Neffe Ludwig zu Stolberg, der den Ausbau fortsetzte. Aus dieser Zeit stammen die gewaltigen runden Bastionen.
Als das Reichslehen 1581 an das Kurfürstentum Mainz fiel, wandelte sich dessen Bedeutung von einem Herrensitz zu einer rein militärischen Nutzung und Staatsgefängnis. Dabei wurde dieser äußerste Punkt der Festung Mainz vor allem unter Erzbischof Johann Philipp von Schönborn weiter modernisiert, heute noch gut erkennbar an den nun eckigen Bastionen im äußersten Gürtel.
Die auf die Französische Revolution folgenden Koalitionskriege brachten die Festung schließlich an ihre Grenzen. 1792 eroberte General Adam-Philippe de Custine erst Mainz und dann auch Königstein. Im Dezember versuchten preußische Truppen vergeblich, die Franzosen wieder aus der Festung zu vertreiben, wobei große Teile der Stadt Königstein zerstört wurden. Die französische Besatzung ergab sich erst im März 1793.
Nur wenige Tage nach Übernahme der Festung durch Mainz mussten eine große Zahl Häftlinge dort untergebracht werden: sogenannte Klubisten oder Jakobiner, denen vorgeworfen wurde, an der Gründung der „Mainzer Republik“ in der französisch besetzten Stadt beteiligt gewesen zu sein. Die bekannteste unter ihnen war sicher Caroline Schlegel-Schelling, später prägende Gestalt der Frühromantik, die sich in ihren Briefen verständlicherweise nicht begeistert von Königstein zeigte.
Mit einer gepfefferten Rechnung für Kost und Logis kamen fast alle Häftlinge in den kommenden Jahren wieder frei. Schließlich wurde die Festung ein weiteres Mal von französischen Truppen erobert, die sich allerdings nicht lange halten konnten. Bei ihrem Abzug im Sommer 1796 versuchten sie, die gesamte Anlage zu sprengen. Dies misslang, führte aber zu großen Schäden. Militärisch nun wertlos, wurden die Reste zur Versteigerung freigegeben. Die Königsteiner besorgten sich hier das Material für den Wiederaufbau ihrer Häuser. Noch heute ist manch wiederverwendeter Stein der Burg an Häusern der Hauptstraße zu entdecken.
Mit Verlust der Garnison begann für das zu einem großem Teil zerstörte Königstein eine rund 50jährige Phase des Niedergangs. Der langsam aufkommende Tourismus, entfacht von Burgenromantikern und Wanderfreunden, brachte zunächst nur dürftigen Ersatz, bis 1852 der Arzt Dr. Pingler hier die Wasserkur etablierte.
Wohlhabende Frankfurter kamen zur Erholung in das sonnenbeschienene Taunusstädtchen. Nach und nach entstanden großzügige Anwesen. Auch der Landesherr, Herzog Adolph von Nassau erwarb mit dem ehemaligen Mainzer Amtshaus am Burgberg eine Sommerresidenz. Er erwarb auch den Burgberg mitsamt der Burg-Ruine. Sein gesamter Königsteiner Besitz blieb sein Eigentum, auch nachdem 1866 Nassau von Preußen annektiert worden war, und er später zum Großherzog von Luxemburg wurde.
Die Burgruine galt mittlerweile als ein romantisches Ausflugsziel und Attraktion des Kurstädtchens. Statt den Abbruch fortzusetzen, begannen erste Instandhaltungsarbeiten. Nach dem Tod Adolphs und seiner Frau Adelheid Marie schenkte deren Tochter, Hilda von Baden, die Burgruine 1922 der Stadt Königstein ursprünglich mitsamt einem großzügig ausgestatteten Fond zu deren Erhaltung. Diesen hatte jedoch die Inflation aufgezehrt, sodass von Beginn an mit der Schenkung der Stadt eine große finanzielle Belastung aufgebürdet war.
Doch die Königsteiner und ihre Gäste lieben die „Burg“, wie die Ruine hier genannt wird. Seit den 1950er Jahren wird jeden Sommer das „Burgfest“ als großes Bürgerfest begangen, organisiert vom Burgverein und mit Unterstützung vieler weiterer Vereine steht es unter der Schirmherrschaft der Angehörige des Fürstenhauses zu Stolberg-Roßla. Mittelalterliche Ritterturnier, Rockfestivals, Kulturevents oder zuletzt als Gast-Burg für Halloween-Geister ist die Ruine das Jahr über Schauplatz vielfältiger Veranstaltungen.
Sie ist ganzjährig geöffnet, in den Wintermonaten nur am Wochenende und zieht auch als Wanderziel die Besucher an. So ist sie in den vom Taunusklub e.V. angelegten 3-Burgen-Wanderweg von Königstein über Falkenstein nach Kronberg eingebunden. Neben den Wandervögeln haben auch die vom Aussterben bedrohten Uhus die alten Gemäuer entdeckt und brüten dort seit einigen Jahren kontinuierlich. Nicht zuletzt findet der Naturschutz seine Beachtung: ein interdisziplinäres Projekt der Stadt Königstein zielt darauf, das Baudenkmal zusammen mit der umgebenden Natur zu schützen und für die zukünftigen Generationen zu erhalten.
Quelle: Stadtarchiv Königstein im Taunus
(C)opyright 2023-2025 - Brüske-Stiftung, alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.